So findet ihr die richtige Methode für eure psychische Gefährdungsbeurteilung
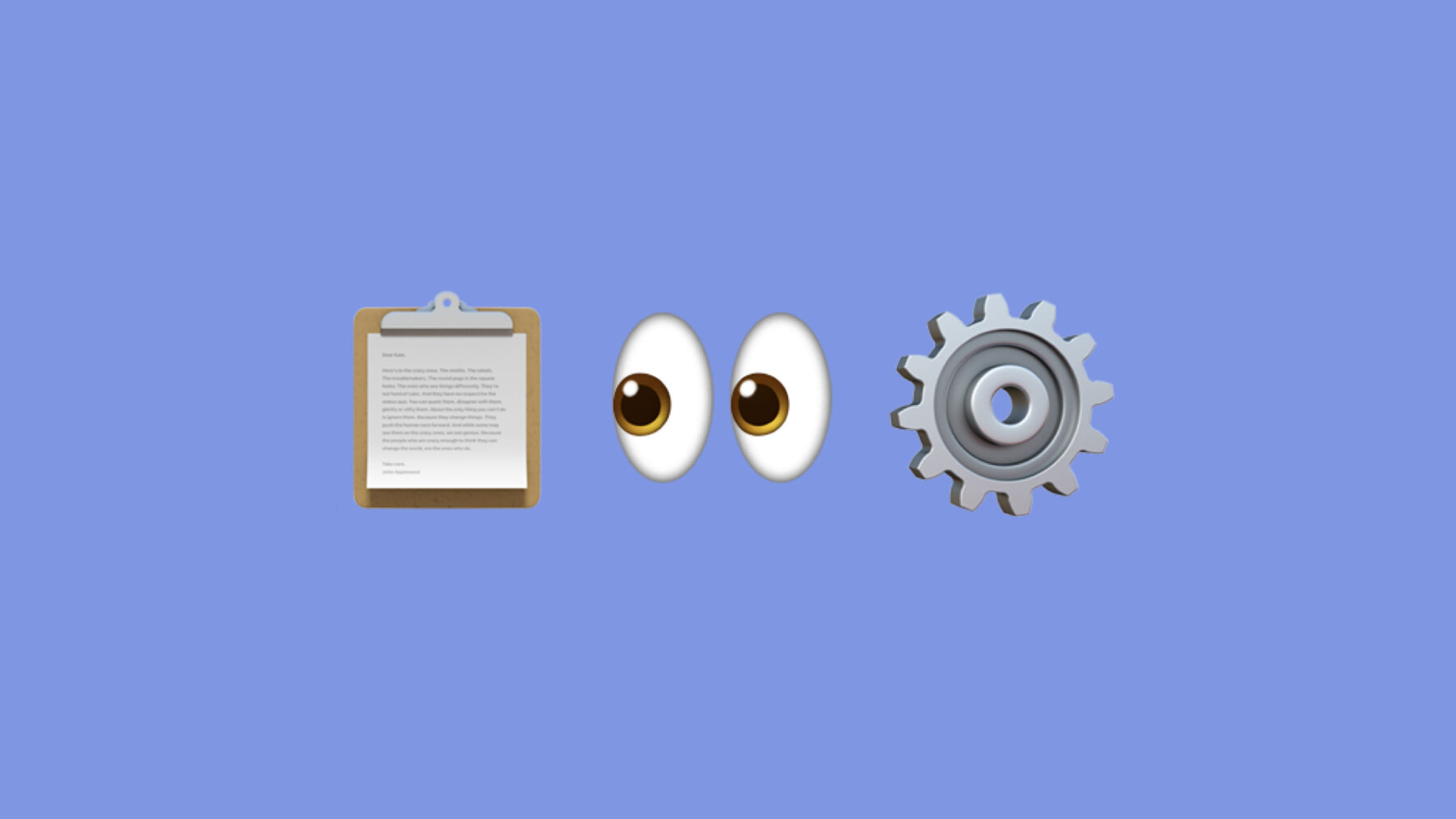
Wenn eure Organisation zu denjenigen gehört, die sich für dieses Jahr die psychische Gefährdungsbeurteilung ganz oben auf die Agenda gesetzt haben: Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Vorsatz, die PGB durchzuführen — und damit psychische Gesundheit wirklich nachhaltig und langfristig zu fördern — seid ihr nämlich noch echte Vorreiter*innen in Sachen Mental Health (bis dato evaluieren erst 21% der Unternehmen psychische Risiken). In unserem letzten Artikel haben wir gezeigt, warum und für wen die psychische Gefährdungsbeurteilung sinnvoll und wichtig ist. In diesem Artikel möchten wir uns dem ‘Wie’ widmen. Denn ist die Entscheidung für die PGB erstmal gefallen, stellt sich für viele Gesundheits- und Personalverantwortliche die Frage nach der richtigen Methode.
Frei, aber nicht beliebig
Zwar sind Unternehmen verpflichtet, die PGB durchzuführen — auf welchem Wege das geschehen sollte, ist aber nicht gesetzlich festgeschrieben. Bei der Auswahl der Verfahren habt ihr also viel Spielraum. Trotzdem ist die Durchführung der PGB auch nicht beliebig. In der Praxis spielen bei der Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Methode häufig folgende Aspekte eine Rolle:
🏅 Die Qualität der Erhebungsmethode (Reliabilität & Validität)
🫳 Die Erreichbarkeit der Beschäftigten
🌎 Die Inklusivität der Methode (Sprache, Schwierigkeitsgrad etc.)
⚖️ Das Preis-Leistungs-Verhältnis
🤯 Die Aussagekraft der Ergebnisse
Oberstes Gebot für die Wahl einer Methode sollte sein, ob ihr die Gefährdungen durch psychische Belastungen damit wirksam erkennen und reduzieren könnt — und das wiederum ist abhängig von den spezifischen Gegebenheiten eurer Organisation (z.B. der Struktur, Anzahl der Mitarbeitenden, etc.). Gut zu wissen: Es gibt keine Pflicht dazu, die psychische Gefährdungsbeurteilung in einem gesonderten Prozess durchzuführen. Ihr könnt sie auch in andere Prozesse der Gefährdungsbeurteilung integrieren (z.B. im Rahmen eurer regelmäßigen Mitarbeitenden-Befragungen oder, um Change-Prozesse zu begleiten).
Aller guten Methoden sind (mindestens) drei
Die psychische Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz ist ein Prozess, bei dem ihr sowohl die mit der Arbeit verbundenen psychischen Gefährdungen als auch die erforderlichen Maßnahmen ermittelt, um diese zu reduzieren. Was viele vergessen: Es gehört auch in den Prozess der PGB, die Maßnahmen umzusetzen und im Nachhinein auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen (!). In der Leitlinie der GDA (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie) sind folgende Prozessschritte vorgeschrieben:
1. Festlegen der Arbeits- und Tätigkeitsbereiche, in denen die psychische Belastungslage ermittelt werden soll
2. Ermitteln der Gefährdungen
3. Beurteilen der Gefährdungen
4. Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen
5. Durchführen der Maßnahmen
6. Überprüfen der Wirksamkeit der Maßnahmen
7. Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung (insbesondere Anpassung im Falle geänderter betrieblicher Gegebenheiten nach § 3 ArbSchG)
Die Verfahren für die Analysephase (Punkt 1–3) und Maßnahmen-entwicklungsphase (Punkt 4–6) dieses Prozesses lassen sich in drei breitere Methodenklassen unterteilen, die wir euch im Folgenden vorstellen möchten. Vorweg sei gesagt: Alle Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Es kann sowohl Sinn machen, sie einzeln zu verwenden — häufig ist jedoch auch eine kombinierte (multi-methodale) Herangehensweise zu empfehlen.

Ihr möchtet eine umfassende Analyse mit überschaubarem Aufwand durchführen? Der standardisierte Fragebogen ist in vielen Unternehmen dafür das Mittel der Wahl. Schließlich erlaubt dieses Verfahren, Belastungsfaktoren besonders umfänglich und gleichzeitig schnell zu erfassen. Für die psychische Gefährdungsbeurteilung werden verschiedene standardisierte Fragebögen genutzt, wie beispielsweise das Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) oder die Salutogentische Subjektive Arbeitsanalye (SALSA). Fragebögen wie diese gehören zu den sogenannten Screening-Instrumenten, die eine breitere aber eher oberflächlichere Beurteilung der Arbeitsbelastungen erlauben.
Die PGB per Fragebogen erlaubt es, viele, potenziell risikobehaftete Arbeitsbedingungen in relativ kurzer Zeit auf einmal abzufragen und dabei alle Beschäftigten zu erreichen. Die Qualität der Auswertung kann je nach Fragebogen jedoch unterschiedlich ausfallen, denn in vielen wird häufig nur die Abweichung eines Unternehmens-Mittelwerts von einem theoretischen Schwellenwert ermittelt. Das erlaubt es zwar, die Ausprägung einer jeweiligen Arbeitsbedingung und ihren ‚potenziellen Risikogehalt‘ zu ermitteln, nicht aber deren tatsächliche Auswirkung auf die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden. Fragebögen, die auch eine sogenannte Zusammenhangsanalyse integrieren, umgehen dieses Problem (dazu weiter unten mehr).
Auch in der Unflexibilität vieler Fragebögen liegt ein Nachteil, denn sie lassen kaum eine Individualisierung an die Gegebenheiten des Unternehmens zu. So hat man am Ende zwar viele Informationen, diese müssen aber noch interpretiert und konkretisiert werden. Um einzelne Aspekte näher zu beleuchten oder Maßnahmen abzuleiten kann es daher sinnvoll sein, die Analyse via Fragebogen mit qualitativen Verfahren zu kombinieren. So lässt sich in einem Workshop z.B. genauer herausfinden, was die Beschäftigten mit dem hoch gewerteten Risikofaktor ‚wenig Wertschätzung‘ genau meinen — und was sie sich wünschen würden, um diesen Umstand zu verbessern.

In manchen Fällen kann es Sinn machen, die psychische Gefährdungsbeurteilung (zumindest zum Teil) mittels Beobachtung oder Beobachtungsinterviews durchzuführen. Bei dieser Methode beobachten speziell geschulte Expert*innen, zum Beispiel Betriebsärzt*innen oder Arbeitspsycholog*innen, die Beschäftigten über einen bestimmten Zeitraum während ihrer Tätigkeit.
Die Beobachtungen sind stichprobenartig und werden häufig durch Kurzinterviews ergänzt. Die beobachtende Person schaut bei der Arbeit zu und notiert die Beobachtungen in einem Analysebogen. Im Anschluss werden die ausgeführten Tätigkeiten anhand von Tätigkeitsmerkmalen wie z. B. dem Entscheidungsspielraum eingestuft. Ermittelt werden hierbei ausschließlich die Merkmale der Tätigkeit, die Mitarbeitenden selbst stehen nicht im Fokus der Beobachtung.
Bei dem Ergebnis handelt sich also um eine Fremdeinschätzung der Belastungssituation, worin sich sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil der Methode offenbart: Auf der einen Seite können mit ihr Belastungen ermittelt werden, die den Beschäftigten selbst vielleicht gar nicht mehr auffallen. Auf der anderen Seite kann das Bild, das bei der Beobachtung entsteht, stark vom subjektiven Erleben der Beschäftigten abweichen, weshalb es sinnvoll sein kann, die Einschätzung durch die Expert*innen durch eine Selbsteinschätzung zu kombinieren.
Ein weiterer Vorteil der Methode ist, dass der Aufwand für die Beschäftigten selbst gering ist. Damit das Ergebnis allerdings nicht der subjektiven Deutung einer einzelnen Fachperson entspricht, sollten bestenfalls 2–3 Beobachter*innen unabhängige Urteile abgeben — das macht die Methode deutlich zeitintensiver als beispielsweise die Evaluation mittels Fragebogen. Beobachtungen lassen sich zudem häufig nur mit einem recht hohen Koordinationsaufwand durchführen.
Ein weiterer Nachteil der Methode liegt darin, dass von den beobachteten Einzelpersonen auf eine größere Gruppe von Beschäftigten generalisiert wird. Deshalb eignet sie sich vor allem für Unternehmen, in denen viele ähnliche und standardisierte Arbeitstätigkeiten und -situationen auftauchen (z.B. logistische Tätigkeiten). Auf diese Weise können einige Arbeitsplätze exemplarisch für alle Arbeitsplätze dieser Tätigkeit untersucht werden. Damit eine Beobachtung zu einer stichhaltigen und qualitativ hochwertigen Evaluation der Belastungssituation führt, ist es unbedingt notwendig, dass die beobachtende Person über die entsprechenden fachlichen und methodischen Kenntnisse verfügt.
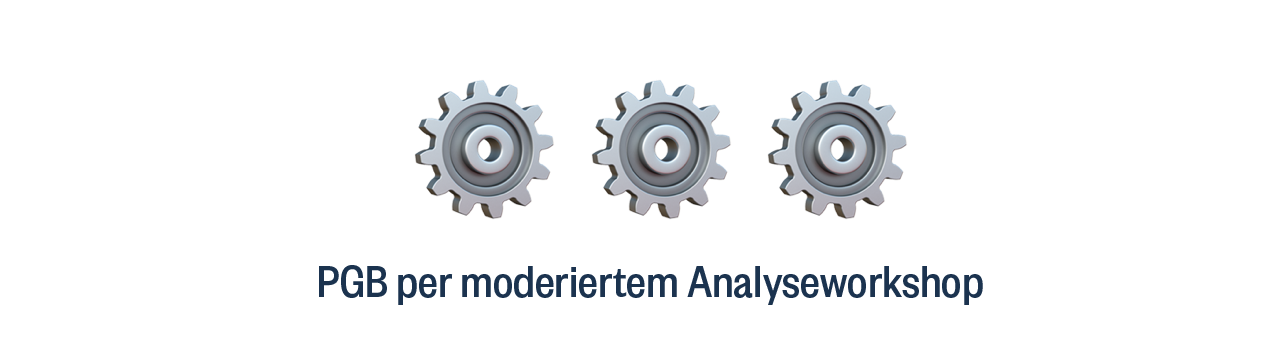
Bei einem moderierten Analyseworkshop kommen etwa 8–12 Mitarbeiter*innen zusammen und teilen — angeleitet durch interne oder externe Expert*innen wie etwa die Gesundheitsmanager*in — ihr Erfahrungswissen. Die Teilnehmenden diskutieren die Ressourcen und Fehlbelastungen ihrer Tätigkeit, die moderierende Person bringt ihr Fachwissen und einen Blickwinkel von außen ein.
Ein Vorteil dieser Methode ist, dass unterschiedliche Perspektiven sehr tiefgehend betrachtet werden und Verbesserungsvorschläge direkt, quasi on the spot, erarbeitet werden können. Die Teilnehmenden des Workshops vertreten die Meinung ihrer Kolleg*innen, was die Ergebnisse — trotz der kleinen Gruppe — praxisrelevant macht. Außerdem ist die Methode sehr ressourcenorientiert, da die Teilnehmenden auch dazu ermutigt werden, zu besprechen, was in der Arbeit alles gut läuft und was sie gesund erhält. Häufig zeigt sich, dass Fehlbelastungen im Rahmen eines Workshops effektiv aufgedeckt und auch bislang unbekannte Schwachstellen kommuniziert werden können — jedoch nur, wenn der Gesprächsraum von den Teilnehmenden als sicher erlebt wird.
Aus diesem Grund sollte im Vorhinein auch gut abgewogen werden, ob Führungskräfte im Workshop anwesend sein sollen, oder nicht. Entscheidet man sich dafür, hat das den Vorteil, dass auch ihre Erfahrungen und Kenntnisse einfließen — und sie die aus dem Workshop entstehenden Maßnahmenvorschläge mit größerer Wahrscheinlichkeit aktiv vorantreiben. Wird die Unternehmenskultur allerdings als psychologisch unsicher erlebt, können anwesende Führungskräfte die offene Diskussion der Teilnehmenden hemmen, da sich die Mitarbeitenden nicht trauen, auf tatsächliche Fehlbelastungen hinzuweisen oder ehrlich ihre Meinung zu sagen.
Wie auch bei der Beobachtung besteht der wohl größte Nachteil der Methode darin, dass nicht alle Beschäftigten mit einbezogen werden können und die Ergebnisse daher nicht repräsentativ für alle Mitarbeitenden sind. Möchte man die Workshops aus diesem Grund über das gesamte Unternehmen hinweg stattfinden lassen, wird das schnell sehr zeit- und kostenintensiv. Da jeder Workshop individuell ist, gibt es außerdem keine Vergleichswerte und es können keine statistischen Zusammenhänge ermittelt werden.
Gern genutzt, aber nicht ausreichend: Checklisten
Für oberflächlichere Wellbeing-Checks werden in vielen Unternehmen auch Checklisten verwendet. Checklisten sind eine Untergruppe des Fragebogens — sie sind deutlich kürzer und daher auch eher den orientierenden Verfahren zuzuordnen. Mit diesen „abgespeckten Fragebögen“ lassen sich abstrakte Screenings durchführen, die nur eine sehr grobe Überprüfung der Arbeitsbedingungen erlauben. Häufig werden sie dann verwendet, wenn es darum geht, einen bestimmten Aspekt (bspw. Führung oder Zusammenarbeit im Team) zu beleuchten. Sie geben einen guten ersten Überblick, erreichen aber nicht die Analysetiefe, die für eine wirksame Evaluation im Rahmen einer psychischen Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz gegeben sein sollte. Um diese zu erreichen, müssen sie mit weiteren Verfahren kombiniert werden.
Neue Tools für einen integrierten Ansatz
Wie in den Beschreibungen der einzelnen Methodengruppen deutlich wurde: Jede bringt ihre Vor- und Nachteile mit sich. Es kann also — gerade für Organisationen, die intern nicht über ausgewiesene Gesundheits- und Arbeitsschutzexpert*innen verfügen — schwierig sein, das richtige Verfahren auszuwählen.
Möchte man von den Vorteilen aller Methoden profitieren und ihre Nachteile abfedern, eignen sich integrierte Ansätze. Digitale Surveys wie die des Corporate Health StartUps DearEmployee etwa kombinieren den quantitativen Methodentyp des Fragebogens mit qualitativen Befragungselementen.
Der wissenschaftlich anerkannte, standardisierte Fragebogen ermöglicht einen systematischen Überblick über die verschiedenen Belastungsfaktoren und deren regelkonforme Auswertung. Außerdem ist in den Survey ein qualitativer Fragenteil integriert, der wichtige Einsichten in die Entstehungsprozesse psychischer Gefährdung gestattet und eine gezielte Maßnahmenempfehlung erlaubt. Die automatische Auswertung des Surveys setzt die Belastungsfaktoren direkt in Verbindung mit der mentalen Gesundheit und umgeht damit das Problem vieler Fragebögen, über keine Zusammenhangsanalyse zu verfügen (siehe oben). In der Praxis kann es trotzdem sinnvoll sein, die qualitative Evaluation mittels anderer Verfahren, wie bspw. eines begleitenden Analyseworkshops, zu vertiefen, um noch validere Aussagen über die Ursachen und geeignete Maßnahmen zu erhalten.
Häufig hilfreich: Der Blick von Außen
Bei der Planung und Durchführung der psychischen Gefährdungsbeurteilung können schnell Fragen und Unsicherheiten entstehen. Externe Expert*innen können euch zu den Grundlagen der PGB beraten, euch Hilfestellung bei der Auswahl der geeigneten Methode geben und euch bei der Durchführung moderierter Analyseworkshops und Beobachtungsverfahren unterstützen.
Externe Beratung bringt weitere Vorteile mit sich: Die Berater*innen agieren als neutrale Akteur*innen, die den Prozess moderieren, zwischen den innerbetrieblichen Stakeholdern vermitteln und zu jeder Zeit als Ansprechpartner*innen zur Verfügung stehen. Beim Kick-Off können sie allen Mitarbeitenden die Relevanz der GB Psych verdeutlichen und die Teilnahmebereitschaft erhöhen. Bei der Ergebnispräsentation können sie die Auswertungen kontextualisieren und fachfremden Entscheider*innen helfen, die relevanten nächsten Schritte zu planen. Außerdem kann ihre Expertise direkt für die Maßnahmenplanung und -umsetzung genutzt werden.
Ihr wünscht euch eben so eine externe Beratung? Wir unterstützen euch gerne und freuen uns auf eure Anfrage via [email protected]